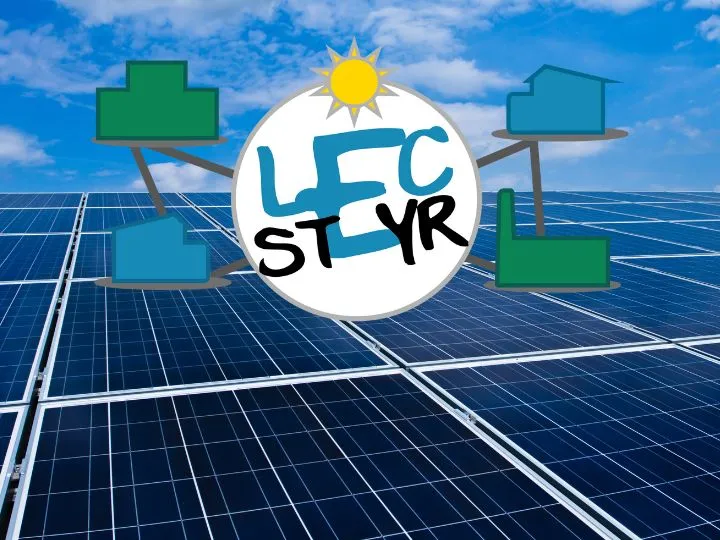
Das Projekt LEC (Local Energy Community) Steyr beinhaltete die Entwicklung und Erprobung von Finanzierungs- und Geschäftsmodellen einer lokalen Energiegemeinschaft in der Stadtgemeinde Steyr.
Das Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Smart Cities Demo - Living Urban Innovation" durchgeführt. Die Abwicklung erfolgte durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG).
Das Projekt LEC (Local Energy Community)-Steyr beschäftigte sich umfassend mit dem Thema der Gründung und des Betriebs Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaften (E-E-G) nach EAG1 und ElWOG2. Konkret wurden im Rahmen des Forschungsprojektes Energiegemeinschaften in drei spezifischen Anwendungsfällen untersucht.
WARUM LOKALE ENERGY COMMUNITIES?
Um den Klimazielen und den Herausforderungen des zukünftigen Energiesystems gerecht zu werden, hat die Europäische Kommission im Winter Package die Schaffung von sogenannten Local Energy Communities (LEC) vorgeschlagen.
LECs ermöglichen es, den dezentralen Stromproduzenten (z.B. eine Photovoltaikanlage) vor Ort die vorhandene Netzinfrastruktur zu nutzen, um Strom direkt an andere Verbraucher innerhalb der Community zu vermarkten bzw. zu tauschen.
Artikel 16 der EU-Direktive sieht vor, dass die Gesetzgebung in den Mitgliedsstaaten dahingehend geändert werden, dass sich Local Energy Communities bilden können.
DIE HERAUSFORDERUNG
Während des Projekts war es eine Herausforderung, an der Definition eines neuen Tarifsystems und Regelwerks zu arbeiten, das den Anforderungen des EU Winter Packages gerecht wird. Im Projekt LEC-Steyr wurde dieser Gedanke aufgegriffen, um entsprechende Betreiber-, Finanzierungs- und Geschäftsmodelle für eine Local Energy Community in Steyr zu entwickeln und im Realbetrieb zu demonstrieren. Dabei spielte vor allem die Einbindung der Zielgruppen eine wesentliche Rolle. Erst über die Erhebung der Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartungen der unterschiedlichen Zielgruppen ließen sich konkrete und zukunftsträchtige Ansätze und Lösungen für Local Energy Communities erreichen.
PROJEKTZIEL
Das Ziel des Projektes LEC Steyr war die Entwicklung eines Konzeptes für den erstmaligen Demonstrationsbetrieb einer Local Energy Community in der Industriestadt Steyr. LECs setzen dazu an, die lokal erzeugte Energie auch lokal zu „vermarkten“, indem innerhalb der LEC Steyr Prosumer den Überschuss direkt an andere Mitglieder der Community über das öffentliche Verteilnetz verkaufen (nur auf Netzebene 6 + 7). Dieser neuartige Stromaustausch bringt Prosumer, Consumer und auch dem Netzbetreiber verschiedene Vorteile, aber auch Herausforderungen und neue Fragestellungen. Daher soll der LEC-Ansatz über verschiedene Anwendungsfelder (gewerblich/industriell, kommunal, privat etc.) ermittelt, modelliert und simuliert werden. Die Entwicklung der notwendigen Regelalgorithmen für den Betrieb gemäß der Geschäftsmodelle, sowie deren Implementierung sind ebenfalls Teil des Projektes. Das so entwickelte Konzept sollte im Rahmen einer Demonstration realisiert und über einen längeren Zeitraum demonstriert, überwacht und analysiert werden.
SCHLUSSFOLGERUNGEN & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die Umsetzung von Energiegemeinschaften ist ein umfassender und komplexer Prozess, bei dem viele Akteure involviert sind. Aus der Erfahrung, die im Laufe des Projektes gesammelt wurden, lassen sich die folgenden Empfehlungen ableiten:
Erwartungen abstimmen
Im Vorfeld der Gründung sollten die grundlegenden Erwartungen hinsichtlich der Themen wie Rechtsform, Tarife, Mitgliederstruktur, wirtschaftliche Ausrichtung, Investitionsvorhaben, etc. erhoben werden. Eine Abstimmung bis ins letzte Detail ist nicht notwendig.
Schaffung eines einheitlichen Mindsets
Bei allen Gründungsmitgliedern sollte ein ähnliches Mindset für die Ausrichtung und die Teilnahme an einer Energiegemeinschaft geschaffen werden, insbesondere für die wirtschaftliche Ausrichtung der Energiegemeinschaft.
Schaffung von Transparenz
Transparenz bei allen Themen (innergemeinschaftliche Regeln, Tarife,...) in Kombination mit einer Nachvollziehbarkeit der Regeln der Energiegemeinschaft ist eine Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Betrieb der Gemeinschaft.
Kosten- und Nutzenwahrheit
Ein wesentlicher Aspekt der Transparenz ist die Kosten- und Nutzenwahrheit in der Energiegemeinschaft. Die Tarifwahl muss nachvollziehbar sein und der Deckung der Kosten oder der Erreichung der gemeinschaftlichen Ziele dienen.
Einseitige Vorteile vermeiden
Bei der Festlegung der Tarife in der Energiegemeinschaft sollen keine einseitigen Vorteile entstehen, außer sie lassen sich gut begründen, wenn beispielsweile ein wirtschaftlicher Vorteil bei der Trägerorganisation der Energiegemeinschaft der Errichtung neuer Erzeugungsanlagen für die Mitglieder dienen soll.
Den richtigen Abrechnungspartner suchen
Für die Betreuung von Energiegemeinschaften stehen unterschiedliche Dienstleister zur Verfügung, die ein breites Portfolio an Dienstleistungen zu unterschiedlichen Konditionen anbieten. Die Wahl des Dienstleisters muss individuell erfolgen, da Energiegemeinschaften unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen.
Um Sicherheit für eine aufgesetzte EEG zu schaffen hinsichtlich frühzeitiger Austritte von Partnern und auch zusätzlicher Partner, sind eindeutige Vertragsmodelle notwendig.
Wahl der adäquaten Rechtsform
Die Wahl der Rechtsform soll die Art der beabsichtigten Mitglieder (Produzenten/Prosumer mit und ohne eigene Anlagen, Konsumenten), die Rechtspersönlichkeit der Mitglieder (Gemeinden/sonstige juristische Personen/natürliche Personen mit und ohne Unternehmen), die erwartete Anzahl der Mitglieder, die steuerlichen Gegebenheiten, den erforderlichen Organisationsgrad sowie die Tauglichkeit für geplante Finanzierungs- und Betreibungsaufgaben berücksichtigen.
Wahl der geeigneten Finanzierung
Die Möglichkeit des freien Ein- und Austritts von Mitgliedern stellt eine hohe Anforderung an die Finanzierung, vor allem dann, wenn Anlagen betrieben werden sollen. Im Hinblick auf das mit der variablen Mitgliedschaft und der Volatilität der Energiepreise verbundene Finanzierungsrisiko werden Formen der Eigenkapitalfinanzierung starke Bedeutung haben.
Ökonomie der Verrechnung
Die Anforderungen an die steuerliche Gebarung, die Rechnungslegung aufgrund der Rechtsformen sind aufgrund des gesteigerten Datenflusses hoch und ist eine automatisierte und standardisierte IT-Plattform wie, zB die von Sebastian Lassacher entwickelte, praktische Voraussetzung für die Abwicklung. Die geringen ökonomischen Vorteile der EEG lassen finanziellen Spielraum für die erforderlichen, unternehmensrechtlichen und steuerlichen Anforderungen. Dieser Situation kann eigentlich nur mit weitgehend vervielfältigbaren Standardmodellen begegnet werden.
Einbindung von Anlagen der Mitglieder
Die Einbindung ist eine reale Notwendigkeit und löst teilweise das Finanzierungsproblem. Dafür müssen die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sein und die richtige ertrags- und umsatzsteuerliche Behandlung an die vertragliche und reale Gestaltung angeknüpft sein.
Verantwortlicher an vorderster Front
Im LEC-Projekt wurde festgestellt, dass das Engagement oft stagniert, wenn es an einer führenden Person mangelt. Es empfiehlt sich, innerhalb der entstehenden Energiegemeinschaft eine motivierte und verantwortungsbewusste Person als Hauptverantwortlichen zu bestimmen. Diese sollte den Austausch mit Dienstleistern koordinieren, Entscheidungen treffen, andere von dem Projekt überzeugen können. Der Enthusiasmus und die Überzeugung dieser Person sind für die nötige Ausdauer, welche die erfolgreiche Inbetriebnahme einer Energiegemeinschaft erfordert, von Bedeutung.
ERGEBNISSE
Im Projekt LEC-Steyr wurden folgende Ergebnisse erzielt:
-
Partizipatives Konzept für die Mitglieder der Energiegemeinschaft
-
Tarifmodell und Rechtsform für die EEG
-
Simulationsmodell für Energiegemeinschaften
-
Software für die Abrechnung von Energiegemeinschaften
-
Demonstration von 2 Energiegemeinschaften
-
Stellungnahme zur Wirtschaftlichkeit von Energiegemeinschaften
-
Stellungnahme zum Gesetzesentwurf vom 16.09.2020
-
Erprobung der Prozesse mit den Netzbetreibern
-
Begleitung der Gründung einer Energiegenossenschaft in Steyr
PROJEKTPARTNER
Antragsteller:
4ward Energy Research GmbH (4ER)
Projektpartner:
• Stadtgut Steyr GmbH
• Verein Forschungs- und Ausbildungszentrum für Arbeit und Technik (FAZAT)
• Clean Capital Energie GmbH (CCE)
• LEVION Technologies GmbH (LEVION)
• Schwarz Kallinger Zwettler Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH (SKZ Moore)
• Stadtbetriebe Steyr GmbH (SBS)
• GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH (GWG)
FÖRDERGEBER
Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Smart Cities - FIT for SET“ durchgeführt.
Infos: www.smartcities.at
STATUS
Abgeschlossen. Im Frühjahr 2023 wurden die aktuellen Erkenntnisse in einem Bericht veröffentlicht - siehe Ergebnisse.
